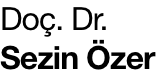Zahnfleischerkrankungen sind ein ernstes Gesundheitsproblem, das mit der Entzündung des rosa Gewebes beginnt, das Ihre Zähne umgibt und sie fest an ihrem Platz hält. Wenn jedoch keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, kann es bis zum Zahnverlust fortschreiten. Diese Erkrankungen betreffen nicht nur Ihren Mund, sondern auch Ihre allgemeine Gesundheit.
Wie sollte gesundes Zahnfleisch aussehen?
Um eine Krankheit zu erkennen, muss man zuerst wissen, was Gesundheit bedeutet. Gesundes Zahnfleisch umschließt Ihre Zähne fest und gleichmäßig – wie der Kragen eines Pullovers. Sein Aussehen und seine Merkmale sind recht charakteristisch.
Die grundlegenden Merkmale eines gesunden Zahnfleisches sind folgende:
- Es ist hellrosa gefärbt.
- Es hat eine feste und dichte Konsistenz:
- Die Oberfläche ist leicht rau und matt wie eine Orangenschale.
- Es umgibt den Zahn mit einer scharfen, messerkantenähnlichen Linie.
- Es blutet beim Zähneputzen oder bei der Verwendung von Zahnseide auf keinen Fall.
- Zwischen Zahn und Zahnfleisch befindet sich eine flache Furche von 1–3 Millimetern Tiefe:
Dieses Bild steht für ein gesundes Gleichgewicht, in dem Ihr Körper in Harmonie mit den Mikroorganismen in der Mundhöhle lebt. Jegliches Bluten, Rötung oder Schwellung ist das erste und wichtigste Anzeichen dafür, dass dieses Gleichgewicht zu kippen beginnt.
Was verursacht Zahnfleischerkrankungen?
Der Hauptschuldige hinter Zahnfleischerkrankungen ist ein klebriger, farbloser Film, den wir „bakterieller Plaque“ nennen. Diese Schicht bildet sich täglich auf unseren Zähnen und besteht nicht nur aus Speiseresten. Sie enthält Millionen von Bakterien, deren Abfallprodukte und Speichel:
Wenn dieser bakterielle Plaque nicht täglich durch effektives Zähneputzen und Zwischenraumpflege entfernt wird, verbindet er sich im Laufe der Zeit mit den Mineralien im Speichel und verhärtet sich. Diese verhärtete Struktur nennen wir „Zahnstein“ oder „Konkrement“. Da die Oberfläche des Zahnsteins rau ist, bietet sie einen idealen Nährboden für die Anlagerung weiterer Plaque und lässt sich mit einer Zahnbürste nicht mehr entfernen. An diesem Punkt ist professionelle Hilfe unerlässlich.
Interessanterweise sind es jedoch nicht direkt die Bakterien selbst, die das Gewebe zerstören. Der Prozess steht vielmehr im Zusammenhang mit dem Abwehrkampf des Körpers gegen diese bakterielle Ansammlung. Unser Immunsystem sendet Entzündungszellen und starke chemische Substanzen in das betroffene Gebiet, um die bakterielle Bedrohung zu beseitigen. Normalerweise ist dies ein Schutzmechanismus. Doch bei manchen Menschen oder bei unkontrollierter Entzündung gerät dieses Abwehrsystem außer Kontrolle. Während der Körper die Bakterien bekämpft, schädigt er versehentlich sein eigenes gesundes Gewebe – also den Knochen und die Fasern, die den Zahn stützen – mit denselben starken Waffen. Kurz gesagt, das Abwehrsystem des Körpers beginnt, seine eigene Festung durch „friendly fire“ zu beschießen. Deshalb ist die Zahnfleischerkrankung keine einfache Infektion, sondern eine komplexe Entzündungskrankheit, bei der das Immunsystem eine zentrale Rolle spielt.
Was ist der Unterschied zwischen Gingivitis und Parodontitis?
Wenn man Zahnfleischerkrankungen als eine Reise betrachtet, gibt es auf dieser Reise zwei wichtige Stationen: Gingivitis und Parodontitis. Der Unterschied zwischen ihnen ist so deutlich wie eine Weggabelung – die eine ist umkehrbar, die andere führt zu bleibenden Schäden.
Gingivitis ist die erste Station dieser Reise und das früheste sowie mildeste Stadium der Krankheit. In diesem Stadium ist die Entzündung nur auf das Zahnfleisch beschränkt. Der Knochen und die Fasern, die den Zahn stützen, sind noch nicht geschädigt. Das typischste Anzeichen ist Zahnfleischbluten. Das Zahnfleisch kann gerötet und geschwollen sein. Da Gingivitis meist schmerzlos verläuft, wird sie oft übersehen oder nicht ernst genommen. Ihre wichtigste Eigenschaft ist jedoch, dass sie vollständig heilbar ist. Durch eine professionelle Zahnreinigung und regelmäßige, richtige Mundpflege zu Hause kann das Zahnfleisch vollständig in seinen gesunden Zustand zurückkehren. In diesem Stadium bestehen keine bleibenden Schäden.
Parodontitis hingegen ist die zweite und gefährliche Station, die sich entwickelt, wenn eine Gingivitis unbehandelt bleibt. In diesem Stadium beschränkt sich die Entzündung nicht mehr nur auf das Zahnfleisch; sie breitet sich auf die Fasern aus, die die Zähne mit dem Kieferknochen verbinden, und auf den Knochen selbst. Die übermäßige Entzündungsreaktion des Körpers beginnt, diese Stützgewebe abzubauen. Infolge dieser Zerstörung entstehen tiefe Räume zwischen Zahn und Zahnfleisch, sogenannte „Taschen“, und der Knochen, der die Zähne hält, wird abgebaut. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Parodontitis ist, dass die verursachten Schäden irreversibel sind. Der verlorene Knochen wächst nicht von selbst nach, es sei denn, es werden fortgeschrittene chirurgische Methoden angewendet. Das Ziel der Behandlung besteht darin, diese Zerstörung zu stoppen und den Zustand zu stabilisieren. Doch auch nach erfolgreicher Therapie bleibt der Patient ein „Parodontitis-Patient“ und muss regelmäßig überwacht werden, um Rückfälle zu vermeiden.
Was sind die Symptome einer Zahnfleischerkrankung?
Zahnfleischerkrankungen verlaufen oft still und schleichend. Da sie meist keine deutlichen Beschwerden wie Schmerzen verursachen, bemerken viele Menschen das Problem erst, wenn es bereits weit fortgeschritten ist. Deshalb ist es wichtig, auf die folgenden Symptome zu achten und beim Auftreten eines dieser Anzeichen sofort einen Zahnarzt aufzusuchen.
Einige häufige Symptome in den frühen Stadien der Krankheit sind:
- Blutung beim Zähneputzen
- Zahnfleischbluten ohne äußeren Anlass
- Rotes, glänzendes und geschwollenes Zahnfleisch
- Ein anhaltender metallischer Geschmack im Mund
- Chronischer Mundgeruch
Wenn die Krankheit fortschreitet und zur Parodontitis wird, treten schwerwiegendere Symptome auf.
- Zahnfleischrückgang
- Zähne wirken länger als zuvor
- Neue Lücken zwischen den Zähnen
- Zahnlockerung oder Zahnwanderung
- Schmerzen beim Kauen
- Eiteraustritt zwischen Zahn und Zahnfleisch
- Veränderung im Zusammenbiss der oberen und unteren Zähne
Wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome bemerken, sollten Sie dies nicht als „normal“ betrachten, sondern unbedingt einen Zahnarzt aufsuchen. Denken Sie daran: Früherkennung ist der wirksamste Weg, Ihre Zähne zu retten.
Wie werden Zahnfleischerkrankungen bei der zahnärztlichen Untersuchung diagnostiziert?
Die Diagnose einer Zahnfleischerkrankung kann nicht allein durch Betrachtung oder das Anhören der Beschwerden des Patienten gestellt werden. Für eine genaue Diagnose ist eine systematische und umfassende Untersuchung erforderlich. Während dieser Untersuchung werden eine Reihe von Messungen und Bewertungen durchgeführt, um das Vorhandensein und den Schweregrad der Krankheit zu bestimmen.
Ein Zahnarzt geht bei der Diagnose folgendermaßen vor:
- Visuelle Kontrolle: Farbe, Form und Konsistenz des Zahnfleisches werden untersucht. Anzeichen von Entzündung wie Rötung oder Schwellung werden gesucht.
- Parodontale Sondierung: Mit einer „Parodontalsonde“, deren Spitze millimetergenau markiert ist, wird an sechs verschiedenen Punkten um jeden Zahn die Tiefe des Raums (Tasche) zwischen Zahn und Zahnfleisch gemessen.
- Blutungsprüfung: Während der Messung wird geprüft, ob an den Stellen, an denen die Sonde das Gewebe berührt, Blutungen auftreten. Blutung ist das deutlichste Zeichen einer aktiven Entzündung.
- Messung des Attachment-Verlustes: Unter Berücksichtigung des Zahnfleischrückgangs wird berechnet, wie viel Stützgewebe der Zahn verloren hat. Dies ist der wichtigste Wert, der das tatsächliche Ausmaß der Zerstörung zeigt.
- Prüfung der Zahnbeweglichkeit: Es wird überprüft, ob sich die Zähne bewegen und, falls ja, in welchem Ausmaß.
- Röntgenuntersuchung: Um das mit bloßem Auge nicht sichtbare Knochengewebe zu beurteilen, werden Röntgenaufnahmen gemacht. Diese zeigen das Ausmaß, die Form und die Verteilung des Knochenverlusts und bestätigen so die Diagnose.
Alle gesammelten Daten werden am Ende dieser Schritte zusammengeführt, um die Diagnose zu stellen. Das aktuelle Stadium (Stufe) und das Fortschreitungsrisiko (Grad) der Erkrankung werden bestimmt, und es wird ein individueller Behandlungsplan erstellt.
Wer ist gefährdet, an Zahnfleischerkrankungen zu erkranken?
Zahnfleischerkrankungen hängen nicht ausschließlich von der Mundhygiene ab. Manche Menschen sind aufgrund genetischer oder lebensstilbedingter Faktoren anfälliger für diese Erkrankung. Das Wissen über Risikofaktoren hilft Ihnen, in Prävention und Behandlung bewusstere Entscheidungen zu treffen.
Es gibt einige Risikofaktoren, die Sie beeinflussen und kontrollieren können:
- Rauchen: Der größte Risikofaktor für Zahnfleischerkrankungen.
- Unzureichende Mundhygiene: Fehlende regelmäßige Entfernung von Plaque und Zahnstein.
- Unkontrollierter Diabetes: Hohe Blutzuckerwerte.
- Starker Stress: Schwächt das Immunsystem des Körpers.
- Fehlerhafte Ernährung: Besonders Vitamin-C-Mangel.
- Bestimmte Medikamente: Blutdruck-, Epilepsie- oder Immunsuppressiva.
Und es gibt Risikofaktoren, die Sie nicht beeinflussen können:
- Genetische Veranlagung: Familienanamnese mit schwerer Zahnfleischerkrankung.
- Alter: Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko.
- Hormonelle Veränderungen: Schwangerschaft, Pubertät oder Menopause.
Das Vorliegen eines oder mehrerer dieser Faktoren bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie erkranken werden. Es zeigt jedoch, dass Sie besonders vorsichtig sein und regelmäßige Zahnarztkontrollen wahrnehmen sollten.
Welche nicht-chirurgischen Behandlungen gibt es bei Zahnfleischerkrankungen?
Der erste Schritt bei der Behandlung der Parodontitis besteht immer in nicht-chirurgischen Methoden. Diese Phase zielt darauf ab, die eigentliche Ursache der Krankheit – bakteriellen Plaque und Zahnstein – zu beseitigen und die Entzündung zu kontrollieren. Sie ist die wichtigste und wirksamste Phase, um die Krankheit ohne chirurgischen Eingriff zu stoppen.
Die Hauptbestandteile dieser Behandlung sind:
- Patientenaufklärung: Der wichtigste Teil der Behandlung ist Ihr Verständnis der Krankheit und Ihre aktive Mitarbeit. Richtige Putz- und Zwischenraumreinigungstechniken werden praktisch vermittelt.
- Professionelle Zahnreinigung (Prophylaxe): Wird bei Gingivitis (der Anfangsstufe der Erkrankung) angewendet und führt durch die Reinigung von Plaque und Zahnstein zu einer vollständigen Heilung.
- Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (SRP): Dies ist die Hauptbehandlung der Parodontitis. Im Volksmund „Tiefenreinigung“ genannt, ist sie weit mehr als eine einfache Reinigung. Unter lokaler Betäubung wird unter das Zahnfleisch gegangen, um alle Ablagerungen und entzündeten Gewebe in den Taschen und auf den Wurzeloberflächen gründlich zu entfernen. Die Wurzeloberflächen werden geglättet, um eine gesunde Wiederanlagerung des Zahnfleisches zu ermöglichen.
- Begleitende Medikamente: Bei hartnäckigen und tiefen Taschen können zusätzlich zu mechanischer Reinigung lokal angewendete Antibiotika oder niedrig dosierte Medikamente verwendet werden, die die übermäßige Entzündungsreaktion des Körpers regulieren.
Etwa 4–6 Wochen nach Abschluss dieser Erstbehandlung erfolgt eine Kontrollsitzung. Dabei wird der Heilungsverlauf beurteilt und entschieden, ob ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist oder ein Erhaltungsprogramm folgt.
Wann ist eine chirurgische Behandlung bei Zahnfleischerkrankungen erforderlich?
Wenn trotz der Anfangsbehandlung tiefe Taschen bestehen bleiben, erheblicher Knochenverlust vorliegt oder in schwer zugänglichen Bereichen weiterhin Entzündung besteht, wird eine chirurgische Behandlung notwendig. Ziel der Parodontalchirurgie ist es, die durch die Krankheit verursachten Schäden zu reparieren, Taschen zu beseitigen und ein gesundes, langfristig leicht zu reinigendes Zahnfleisch zu schaffen.
Die häufigsten chirurgischen Verfahren sind:
- Lappenoperation: Dabei wird das Zahnfleisch chirurgisch vorsichtig angehoben, um direkten Zugang zu den Wurzeloberflächen und zum Knochen zu erhalten. So können tiefgehende Reinigungen durchgeführt und das Knochengewebe neu geformt werden.
- Knochenaufbau (Knochenaugmentation): In durch die Krankheit abgebauten Bereichen werden Knochentransplantate (Knochenersatzmaterial) eingebracht, um neues Knochenwachstum zu stimulieren.
- Geführte Geweberegeneration: Über den Knochenaufbau wird eine spezielle Membran gelegt, die den Bereich von anderem Gewebe isoliert. So können sich nur Knochenzellen vermehren und neues Knochengewebe bilden.
- Weichgewebetransplantate: Ein dünnes Gewebestück – meist aus dem Gaumen entnommen – wird transplantiert, um Zahnfleischrückgänge zu behandeln und freiliegende Wurzeln zu bedecken.
- Kronenverlängerung: Chirurgische Neugestaltung von Zahnfleisch und Knochen, um die Zähne ästhetisch zu verlängern oder tiefliegende Karies behandelbar zu machen.
Welche Methode für Sie geeignet ist, hängt von Faktoren wie der Art der Erkrankung, der Form des Knochenabbaus und Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand ab.
Wie wird der Heilungsprozess nach der Zahnfleischbehandlung gesteuert?
Der entscheidende Punkt bei der Behandlung der Parodontitis ist das Bewusstsein, dass dies kein Ende, sondern ein Anfang ist. Parodontitis ist eine chronische Erkrankung, das heißt, sie verschwindet nie vollständig – sie wird lediglich kontrolliert. Daher ist die Nachsorgephase mindestens genauso wichtig wie die Behandlung selbst und erfordert lebenslange Aufmerksamkeit.
Für den dauerhaften Erfolg der Behandlung sind zwei Faktoren entscheidend: professionelle Pflege und persönliche Pflege.
Professionelle Pflege (Parodontale Erhaltungstherapie): Ein behandelter Parodontitispatient benötigt keine gewöhnliche Zahnsteinentfernung mehr. Stattdessen sind spezielle Nachsorgetermine erforderlich, die als „unterstützende parodontale Therapie“ bezeichnet werden. Diese Sitzungen finden in der Regel alle drei Monate statt und dienen dazu, ein Wiederaufflammen der Krankheit zu verhindern.
Zu den Hauptmaßnahmen dieser Nachsorgetermine gehören:
- Aktualisierung Ihres allgemeinen Gesundheitszustands
- Bewertung Ihrer Mundhygienegewohnheiten
- Erneute vollständige parodontale Untersuchung
- Gründliche Reinigung mit Fokus auf Risikobereiche
- Verstärkung der Hygieneroutine bei Bedarf
Persönliche häusliche Pflege: So gut die professionelle Pflege auch sein mag – ohne Ihre tägliche Mitwirkung ist dauerhafter Erfolg unmöglich.
Die wichtigsten Regeln für die häusliche Pflege sind:
- Mindestens zweimal täglich zwei Minuten lang mit der richtigen Technik putzen.
- Täglich die Zahnzwischenräume reinigen (mit Interdentalbürste oder Zahnseide).
- Von Ihrem Zahnarzt empfohlene spezielle Mundpflegeprodukte verwenden.
- Risikofaktoren wie Rauchen vermeiden.
- Systemische Erkrankungen wie Diabetes unter Kontrolle halten.

Der Kinderzahnarzt Assoz. Prof. Dr. Sezin (Sezgin) Özer, der die Samsun Bafra Anatolische Oberschule und die Fakultät für Zahnmedizin der Hacettepe-Universität absolvierte, schloss seine Promotion in der Abteilung für Kinderzahnheilkunde (Pedodontie) an der Fakultät für Zahnmedizin der Ondokuz-Mayıs-Universität ab. Zwischen 2001 und 2018 arbeitete er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Spezialist und Dozent. Im April 2018 verließ er die Universität und begann, in seiner eigenen Kinderzahnarztpraxis zu arbeiten.